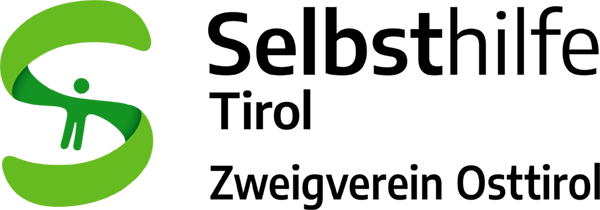PODIUMSDISKUSSION „WIE TRAUMA ZU DRAMA FÜHRT UND WAS SUCHT DAMIT ZU TUN HAT“
Mittwoch, 28. Mai 2025 in Heinfels – Gemeindesaal
Sonja BERTOLLINI – SH-Gruppe Lebensfreude
Markus WARSCHER – “Mein leises Leben mit einem lauten Tabu”
Dr. Jaqueline LASSNIG – BKH Lienz – Abteilung Psychiatrie
Peter SYKORA – SH-Gruppe A-h-A/Alkoholkranke helfen Alkoholkranken
SABINE BUCHBERGER – HPE – Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter
Wolfgang RENNHOFER – Moderation
„Trauma, Drama, Sucht. Diese drei Begriffe gehören oft zusammen, werden aber selten gemeinsam gedacht.
Ende Mai fand die Podiumsdiskussion „WIE TRAUMA ZU DRAMA FÜHRT UND WAS SUCHT DAMIT ZU TUN HAT“ statt.
Dankenswerterweise stellte die Gemeinde Heinfels mit Bürgermeister Georg Hofmann den Gemeindesaal kostenlos zur Verfügung.
Ziel dieser Informationsveranstaltung war es die Entstehung von psychischen Verletzungen zu verstehen, Verhaltensweisen von Betroffenen zu erkennen und nachvollziehen zu können sowie hilfreiche Wege aus der Abhängigkeit zu finden.
Sonja Bertolini, der Initiatorin dieser Veranstaltung, war es ein großes Bedürfnis das Thema Trauma und Sucht aus der Tabuzone heraus zu führen. Sie schilderte welch enormes Ausmaß narzisstische Beziehungen für die Entstehung eines Traumas haben können.
OÄ Dr. Lassnig erklärte, dass jedem Trauma eine körperliche und/oder seelische Verletzung vorausgeht. Es gibt vier verschiedene Ursachen:
- Bindungstrauma: körperlicher, sexueller, psychischer Missbrauch, emotionale Vernachlässigung, oder nahe Bezugspersonen die früh sterben.
- Monotrauma (Vergewaltigung, Unfall)
- Langandauernde Traumata (Folter, Geiselhaft)
- Traumata durch Organisierte Gruppierungen (z.B. Sekten)
Die Symptome einer Traumatisierung sind wie ein Blumenstrauß zu verstehen: Panikattacken, Schlafstörungen, Ängste, Reize und Erinnerungen aus der Vergangenheit wie Gerüche, Geräusche, Flashbacks usw… Eine Traumafolgestörung wird dadurch lange nicht als solche erkannt.
Sucht und Trauma sind wie Bruder und Schwester. 75% der Suchtpatienten sind auch Traumapatienten. Alkohol hat die Funktion, so wie jedes Suchtmittel die Funktion hat, den seelischen Schmerz zu betäuben. Diese Strategie wurde schon in vielen vorangegangenen Generationen erfolglos angewandt.
Im ersten Schritt einer erfolgreichen Suchtbehandlung ist es wichtig Abstinenz zu erreichen. Danach kann das Trauma mit einer dementsprechenden Traumatherapie behandelt werden.
Psychisch erkrankte Menschen werden leider oft nicht verstanden. Auch die Hirnforschung kann es noch nicht richtig erklären, das ist das Problem, so Dr.in Lassnig. Ziel muss zukünftig sein, dass psychische Erkrankungen gleichwertig den körperlichen Erkrankungen von der Gesellschaft behandelt werden. Vertrauensvolle Menschen mit Verständnis sind im Umfeld der Erkrankten sehr wichtig.
Peter Sykora leistet intensive Aufklärungsarbeit zum Tabuthema „Alkoholabhängigkeit“ und stellt die Frage: „Warum muss ich als kranker Alkoholiker anonym sein?“ Er beschreibt den Teufelskreis „Verletzung – Trauma – Ablenkung mit Alkohol“, der am Ende zu keiner Lösung führt, denn die seelische Verletzung bleibt. Mitglieder der Selbsthilfegruppe AhA berichten, dass sie, seitdem sie sich in der Gruppe austauschen und unterstützen, mit dem Trinken aufgehört haben und auch die Panikattacken weniger wurden bzw. ganz ausbleiben.
Scham ist leider immer noch ein sehr großes Hindernis, sich zu öffnen, doch Reden hilft! Peter Sykora fragt sich aber: „Warum muss man seine Alkohol-Abstinenz in der Gesellschaft mit einer Ausrede rechtfertigen (ich nehme Medikamente, ich fahre Auto..). Er wünscht sich mehr Verständnis und Aufmerksamkeit für gefährdete Personen. Reden hilft. Und er findet es wichtig, bei Menschen, bei denen man den Eindruck hat, dass es ihnen nicht gut geht, nachzufragen und zuzuhören.
„Jeder Tag ist eine Herausforderung mit Panikattacken und anderen psychischen Symptomen“, beschreibt Markus Warscher seine Situation und gibt Tipps zum Umgang damit. Wichtig ist es für ihn alkoholfrei zu bleiben und verordnete Medikamente regelmäßig einzunehmen.
Aufgrund der „Pflicht zu funktionieren“, in Familie oder bei der Arbeit…, vergisst man Hilfe anzunehmen, so seine Meinung. Doch das Leben wird so immer anstrengender, bis nicht mehr geht. Das war sein Zeitpunkt Hilfe anzunehmen und mittlerweile gibt es in Osttirol viele Institutionen die Hilfe anbieten, so seine Aussage.
Hilfe geben bedeutet für ihn auch sogenannte „Außenseiter“ auf ihr Verhalten anzusprechen und eventuelle Unterstützung anzubieten.
Es gibt wesentlich mehr Angehörige als Betroffene, sagt Sabine Buchberger, was auch verständlich ist. Hilfe Für Angehörige bietet der Verein HPE österreichweit. Angeboten werden spezielle Schulungen und Tipps für Angehörige, nachzulesen auf der Homepage von HPE.
Angehörige und Freunde sollten lernen Grenzen zu setzen, um die eigene Stabilität zu erhalten, die zur Hilfestellung Erkrankter notwendig ist, aufrecht zu erhalten.
Eine falsche und dramatische Volksmeinung lautet: „Psychische Erkrankungen gibt es nicht, die sollen alle mal richtig arbeiten“. Dieser unprofessionellen Meinung muss man durch Information und Aufklärung entschieden entgegentreten, so ihre klare Botschaft.
Meine Erkenntnis als Moderator zu diesem Thema lautet: „Stärke bedeutet: Bei Bedarf früh genug Hilfe annehmen, um einer Chronifizierung der Erkrankung entgegenzuwirken.
Darum empfehle ich Mut zum Gespräch, denn es gibt viele Möglichkeiten zur Erarbeitung nachhaltiger Lösungen.
Egal ob, man selbst betroffen ist oder sich in der Rolle des Angehörigen oder des Freundes befindet.“